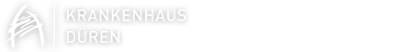Das MVZ für Histologie, Zytologie und molekulare Diagnostik Düren
Pathologie – was sich dahinter verbirgt
Oder beginnen wir besser damit, was sich nicht dahinter verbirgt. Den meisten Menschen verursacht das Wort Pathologie eher Unbehagen, weil es mit dem Tode assoziiert und der Pathologe oftmals als „Leichenarzt" betrachtet wird. Diese Fehleinschätzung wird durch die unzählbaren Krimiserien genährt, da in diesen der am Tatort oder im Obduktionssaal tätige Mediziner in aller Regel als Pathologe bezeichnet wird – und dies eben stimmt nicht. Die dort dargestellten Ärzte sind Rechtsmediziner. Sie haben eine gänzlich andere Facharztausbildung als wir Pathologen und befassen sich mit allen Fragen des unnatürlichen Todes.
Die einzige Schnittmenge zwischen Pathologie und Rechtsmedizin ist die Arbeit im Obduktionssaal, die bei ersterem die Hauptbeschäftigung ist aber ganz andere Fragen beantwortet als die Obduktion, die vom Pathologen durchgeführt wird, nämlich die Frage nach den natürlichen Todesursachen. Die Hauptaufgabe der heutigen Pathologie ist die mikroskopische und molekularbiologische Diagnostik von Erkrankungen an Zellen oder Geweben.
Nahezu jede Krebsdiagnose wird vom Pathologen gestellt und ohne unsere histologische oder zytologische Diagnose findet keine onkologische Therapie statt. Deswegen wird vor einer Krebsbehandlung immer eine diagnostische Gewebsentnahme durchgeführt, welche der Pathologe befundet. Ergibt der Befund, dass eine chirurgische Organentfernung erforderlich ist, wird dieses Präparat ebenfalls zur pathologischen Befundung geschickt. Unser Befund gibt dann zum einen das Erkrankungsstadium an, welches die Basis aller weiterführenden Behandlungen ist. Zum anderen untersuchen wir mit einer Vielzahl moderner Methoden spezifische Gewebseigenschaften von Tumoren, welche Auskunft über weitere Therapiemöglichkeiten und auch über den zu erwartenden Krankheitsverlauf geben. Der Pathologe sitzt heute in vielen interdisziplinären Konferenzen und berät gemeinsam mit den direkt am Patienten tätigen Ärzten über das therapeutische Vorgehen. Deswegen ist das Fach Pathologie heute eine klinische Disziplin geworden und steht am Anfang der allermeisten Therapien und nicht am Ende des Lebens.
Das Leistungsspektrum in unserem MVZ
-
Histologische Untersuchungen – das tägliche Handwerk des Pathologen
Histos stammt aus dem Griechischen und heißt Gewebe.
Die meisten Erkrankungen führen zu anatomischen Veränderungen des Gewebes, und genau diese untersucht der Pathologe am Mikroskop. Im Prinzip muss man sich die Arbeit des Pathologen so vorstellen, dass er am Tag hunderte von Bildern betrachtet und versucht, daraus eine Krankheit zu diagnostizieren. Um dem Gewebe ein Bild zu entlocken, ist eine lange Kette verschiedener Maßnahmen erforderlich.
An deren Anfang steht die Fixierung – das Haltbarmachen des Gewebes, weil es ohne dies schlicht verderben würde. Dann müssen hauchdünne (2 Mikrometer!) Schnitte hergestellt und gefärbt werden, weil das Gewebe anders nicht im Mikroskop betrachtet werden kann. Zu diesem Zweck wird das Gewebe in ein gut schneidbares Medium eingebettet – Paraffin eignet sich dazu hervorragend.
Da Gewebe zu 70% aus Wasser besteht, sich dieses aber nicht mit Paraffin mischen lässt, muss das Gewebe entwässert werden, dann kommt es ins Paraffin, wird geschnitten, auf Objektträger aufgezogen und muss dann wieder in die wässrige Phase überführt werden, weil alle Gewebsfärbungen wasserbasiert sind. Danach wird ein Deckglas aufgeklebt und fertig ist das histologische Präparat, welches aus juristischen Gründen 10 Jahre archiviert werden muss. Also ein recht aufwändiger, komplizierter Prozess, der bunte, manchmal sogar künstlerisch eindrucksvolle Bilder generiert, die ganz wesentlich die Behandlung eines Patienten bestimmen.
-
Schnellschnittuntersuchungen – für dringliche Entscheidungen
Die übliche histologische Untersuchung ist ein zeitaufwändiges Verfahren und liefert ihr Resultat meistens innerhalb von 24 Stunden.
Manchmal sind aber umgehende Entscheidungen erforderlich. Dies ist vor allem während operativer Eingriffe der Fall, wo es manchmal vom pathologischen Befund abhängt, in welcher Weise die Operation fortgeführt wird.
In einer solchen Situation muss das Ergebnis in möglichst kurzer Zeit – innerhalb von 10-20 Minuten vorliegen. Dazu wird das Gewebe in frischem, unfixiertem Zustand zu uns geschickt. Um den sonst für das Schneiden erforderlichen komplizierten Einbettprozess zu umgehen, wird das Gewebe gefroren um so eine schneidbare Konsistenz zu erzielen.
-
Immunhistochemische Untersuchungen
Obwohl konventionelle Färbungen uns bereits viel über die Zusammensetzung eines Gewebes verraten, langt dies manchmal nicht aus.
Wenn eine Information über das Vorhandensein bestimmter Proteine erforderlich ist, kommen immunhistochemische Untersuchungen zum Einsatz.
Dazu nutzen wir Antikörper, die genau so wie bei einer immunologischen Abwehrreaktion, das spezifische Protein, gegen das sie hergestellt wurden, im Gewebsschnitt erkennen und daran binden. Der gebundene Antikörper wird dann färberisch zur Darstellung gebracht und gibt so Aufschluss darüber, wo das Protein sitzt und in welcher Menge es ungefähr vorhanden ist.
Diese Methode ist heute unverzichtbarer Bestandteil der diagnostischen Arbeit des Pathologen. Sie hilft nicht nur, schwierige differentialdiagnostische Fragen zu lösen, sondern ist auch für den Nachweis von therapeutisch relevanten Zielstrukturen im Tumorgewebe wichtig. Man kann sogar sagen, dass die Immunhistochemie in den knapp 50 Jahren ihrer Existenz die diagnostische Pathologie revolutioniert hat.
-
Zytologische Untersuchungen
Im Gegensatz zur histologischen Untersuchung, welche den gesamten Gewebsverband analysiert, ist das Objekt der zytologischen Untersuchung die Einzelzelle.
Der Vorteil dieser Methode ist, dass zytologische Materialien relativ einfach zu gewinnen sind: etwa durch Abstriche (z.B. vom Gebärmutterhals), spontan abgelöste Zellen in Ergüssen oder im Urin, oder über eine Punktion gewonnene Zellen (z.B. aus der Schilddrüse).
Der Nachteil ist, dass durch die Reduktion auf die Einzelzelle das diagnostische Spektrum weniger breit ist als das der histologischen Untersuchung. Deswegen ist die Domäne der Zytologie auch die Vorsorgeuntersuchung, da damit Patienten selektioniert werden können, die engmaschig kontrolliert oder direkt histologisch abgeklärt werden müssen.
-
DNA-Bildzytometrie
Ein wesentliches Merkmal der meisten bösartigen Tumoren ist es, dass deren Zellen einen abnormen Gehalt an DNA – unserer Erbsubstanz – haben.
Die DNA-Bildzytometrie dient dazu, den DNA-Gehalt einer Zellpopulation zu bestimmen. Aus dessen graphischer Darstellung kann man ablesen, ob die Zellen wahrscheinlich von einem bösartigen Tumor stammen und bei manchen Tumoren – wie z.B: dem Prostatakarzinom – auch, den Grad der Bösartigkeit.
Deswegen hilft diese Methode zum einen bei der differentialdiagnostischen Abschätzung, ob ein bösartiger Tumor vorliegt und zum anderen, wie aggressiv der Tumor sich verhalten wird.
-
Molekularpathologie
Das Wesen des Faches Pathologie ist es ja, krankheitsrelevante anatomische Veränderungen eines Gewebes zu verstehen und diagnostisch einzuordnen.
Nun ist es aber so, dass nicht alle Erkrankungen mikroskopisch nachweisbare (also strukturelle) Gewebsveränderungen hervorrufen. Dies hat 1851 schon Rudolf Virchow, der wohl berühmteste deutsche Pathologe, geschrieben, ohne dass diese Feststellung damals nennenswerten Einfluß gehabt hätte.
Heute spielt dagegen die Suche nach krankhaft veränderten Molekülen eine sehr große Rolle, nicht nur für die Forschung, sondern ganz besonders für die onkologische Therapie. Beim Brustkrebs ist die Frage, ob im Tumorgewebe Östrogenrezeptoren exprimiert werden oder ob das Molekül HER2 in der Zellmembran verstärkt gebildet wird, therapieentscheidend.
Beim Dickdarmkarzinom spielt der Nachweis von Mutationen im k-ras-Gen, beim Lungenkrebs Mutationen im EGFR-Gen, beim Melanom Mutationen im B-raf-Gen eine therapiebeeinflussende Rolle. Auch für die Diagnostik von Infektionserkrankungen ist die Molekularpathologie heute unverzichtbar, da deren Sensitivität für bestimmte Keimnachweise viel höher ist als die der konventionellen Färbemethoden und manche Nachweise damit auch viel schneller von statten gehen, als dass mit konventionellen mikrobiologischen Verfahren möglich ist.
Die am häufigsten durchgeführten molekularpathologischen Erregernachweise sind die für HPV und Mykobakterien, gefolgt von CMV, EBV, verschiedene Pilze u.v.a.m.
-
Die Obduktion – Pathologie im klassischen Sinne
Unter dem Begriff versteht man die innere und äußere Leichenschau welche die Feststellung von Grundleiden und unmittelbarer Todesursache zum Ziele hat.
Die Obduktion ist das klassische Instrument der Pathologie und bestimmte die Tätigkeit des Pathologen bis in die 60er Jahre hinein. Heute ist die Zahl der Obduktionen in einem Besorgnis erregenden Ausmaß gesunken. In den großen Instituten der neuen Bundesländer wurden bis zur Wiedervereinigung z.T. über 2000 Obduktionen pro Jahr durchgeführt.
Heute wird selbst in großen Universitätsinstituten oft nicht einmal der zehnte Teil dieser Ziffer erreicht. Die Obduktionsrate beträgt in Deutschland gegenwärtig gerade einmal 0.1% aller Verstorbenen. Die Gründe für die drastische Abnahme der Obduktionsrate sind vielgestaltig und lassen sich definitiv nicht ausschließlich auf gesetzliche Regelungen reduzieren.
Wenden wir uns der Frage zu, warum diese Situation unbefriedigend ist. Die Obduktion nützt dem Verstorbenen selbst nichts mehr – so viel ist klar. Sie ist aber für die Gesellschaft von großem Nutzen. Zum einen ist die Todesursachenstatistik, aus welcher ja epidemiologische Trends und damit auch gesundheitspolitische Entscheidungen abgeleitet werden ohne adäquate Obduktionskontrolle zu fehlerhaft, um als ernstzunehmende Basis gelten zu können. Zum anderen war und ist die Obduktion ein Mittel zum Erkenntnisgewinn. Die Zeiten sprunghafter Entwicklungen in der jüngeren Medizingeschichte waren sehr oft mit einer entsprechenden Entwicklung im Fach Pathologie begleitet.
Dies wird deutlich, wenn man die Wiener Schule (Karl von Rokitansky) und die Bedeutung von Rudolph Virchow betrachtet. Auch heute, in der Zeit einer hoch entwickelten modernen Medizin mit hervorragender Bildgebung und dominante molekularbiologischer Forschung hat sie ihren Stellenwert als das, was sie schon immer war – das Gewissen der Medizin.
Chefarzt

Prof. Dr. med. Bernd Klosterhalfen
Chefarzt und Geschäftsführer der Praxisgemeinschaft
Kontakt
Institut und Praxisgemeinschaft für Pathologie
Merzenicher Straße 37
D-52351 Düren
Sekretariat: Frau Krüger
T 02421 9989-211
F 02421 9989-499
bernd.klosterhalfen@web.de
Informationen zum Versandmaterial
-
Histologie und Zytoeinsendungen
- Hol- und Bringedienst des Institutes
- Postversand mit vorfrankiertem Versandmaterial
-
Befundversand
- Hol- und Bringedienst des Institutes
- Per Post
- Bei Eilfällen oder wichtigen Befunden per Telefon und / oder Telefax
-
In der Zytologie Erstellung von
- Vergleichsstatistiken für die Qualitätssicherung
- Recall-Listen für Patienten mit kontrollbedürftigen Befunden
- Individualisierte Patientenanschreiben mit Ihrem Briefkopf zwecks Wiedervorstellung bei kontrollbedürftigen Befunden
-
Individuelle Beratung zum diagnostisch-therapeutischen Vorgehen bei Problemfällen
- Fixation von Gewebeproben: 4 % gepuffertes Formalin
- Fixation von Schilddrüsen-Punktaten: Ausstrichpräparate lufttrocknen.
- Fixation gynäkologische Ausstrichpräparate: Alkoholfixation (Alkoholspray)
Labore
Schnellschnittlabor und Eingangslabor
T 02421 9989-101
F 02421 9989 499
Färbelabor
T 02421 9989-118
F 02421 9989-499
inge.krueger@pathodn.de
Zytologielabor
T 02421 9989-105
F 02421 9989-499
claudia.banfai@pathodn.de
Externe Standorte
Schnellschnittlabor Kreiskrankenhaus Mechernich
T 02243 171245
F 02421 9989-499
Schnellschnittlabor St.-Antonius-Hospital Eschweiler
T 2403 761581
F 02421 9989-499
Über uns - Daten und Fakten
Ärzte für Pathologie und Molekularpathologie
In der Praxis werden alle morphologischen Basis- und Spezialuntersuchungen durchgeführt. Hierzu gehören in erster Linie gynäkologische, gastroenterologische, urologische, dermatologische, chirurgische Routine- und Schnellschnittdiagnostik sowie die gynäkologische und die extagynäkologische Zytologie. Die Praxisgemeinschaft besteht aus sieben Fachärzten und 46 weiteren Mitarbeitern.
- Histopathologische Befunde pro Jahr: rd. 60.000
- Zytopathologische Befunde pro Jahr: rd. 6000
- Jährlich werden bis zu 80 Obduktionen durchgeführt.
Weitere Standorte
- Zweigstelle Düsseldorf
- Zweigstelle Eschweiler
- Zweigstelle Mechernich
Wir betreuen
- Euregio Brustzentrum in Eschweiler und das Brustzentrum Düren
- Prostatazentrum Eschweiler.
- Darmkrebszentrum Düren
Konferenzen
- Brustzentrum Eschweiler (EBZ) jeden Mittwoch um 16:00 Uhr im St. Antonius Hospital Eschweiler
- Brustzentrum Düren jeden Mittwoch 17:00 Uhr
- Prostatazentrum jeden Montag um 18:00 Uhr im St. Antonius Hospital in Eschweiler
- Tumorboard St. Antonius Hospital Eschweiler jeden Montag 15:30 Uhr
- Tumorboard in Stolberg jeden ersten Mittwoch im Monat 13:00 Uhr
- Onkologische Konferenz in Düren wöchentlich
In der Spezialdiagnostik stehen sämtliche modernen diagnostischen Methoden zur Verfügung. Immunhistochemische und immunzytochemische Methoden werden vor Ort im Institut mit 93 Antikörpern durchgeführt. In Zusammenarbeit mit zehn anderen Kliniken und Instituten für Pathologie erfolgt eine breit gefächerte molekularpathologische Diagnostik im Labor der GenOPath. Eine Spezialisierung der Mitarbeiter in Teilgebieten der Pathologie soll anspruchsvolle Bereiche auf internationalem Niveau abdecken.
Spezialgebiete
- Prof. Dr. med. Bernd Klosterhalfen: Orthopädie, Abdominalchirurgie, Pathologie des Bewegungsapparates, Biomaterialien.
- Dr. med. Monika Meybehm: Hämatopathologie, Dermatopathologie, gynäkologische Zytopathologie
- Dr. med. Angela Cupisti: Uropathologie
- Prof. Dr. med. Peter Röttger: Oralpathologie, Beurteilung der Morphologie artikulärer Therapien
- Prof. Dr. med. Christian Mittermayer: Oralpathologie
Wir legen viel Wert auf Aus- und Weiterbildung!

Mit höchstem Qualitätsanspruch trägt das Krankenhaus Düren eine besondere Verantwortung für die Gesundheitsversorgung in der Region. Darüber hinaus sehen wir uns als Akademisches Lehrkrankenhaus der RWTH Aachen aber auch in der Pflicht, umfassende und hochwertige Bildungsangebote zu machen. So auch in der Pathologie.